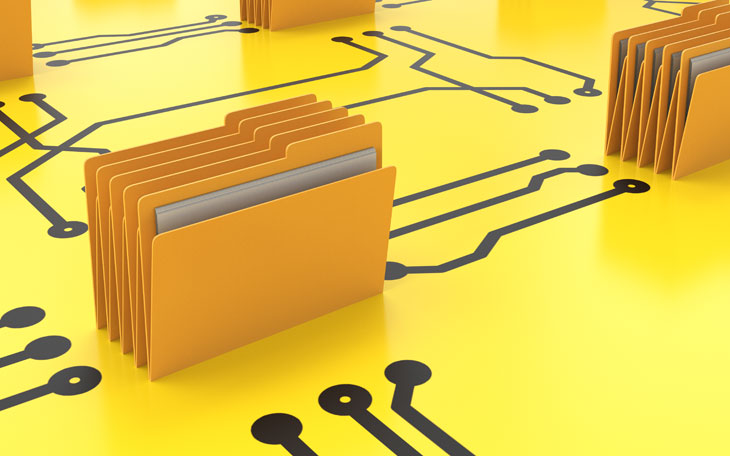Die im europäischen Vergleich schleppende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist laut dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft nicht in erster Linie auf die Komplexität der föderalen Strukturen oder starre Verwaltungstraditionen in Deutschland zurückzuführen, sondern auf einen Mangel an marktlichem Wettbewerb, was die Entwicklung innovativer und kosteneffizienter Lösungen behindert.
„Trotz zahlreicher Initiativen und Gesetzte in den letzten Jahren belegt Deutschland im europäischen Vergleich hinsichtlich der Verwaltungsdigitalisierung weiterhin einen der hinteren Plätze“, konstatiert der Sprecher des Kronberger Kreises Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld und warnt: „Dies bedeutet nicht nur, dass die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und Politik zunehmend eingeschränkt wird, sondern es entstehen dadurch entscheidende wirtschaftliche Wettbewerbsnachteile.“
Laut Prof. Dr. Justus Haucap würden bisher vor allem die föderalen Strukturen und die ausgeprägte Regelbindung der deutschen Verwaltungstradition als Digitalisierungshemmnisse diskutiert. „Ein dezentraler Staatsaufbau stellt allerdings nicht per se ein Hindernis für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie dar, wie empirische Untersuchungen zeigen“, unterstreicht Haucap. In Deutschland sei die mangelnde Koordination von Bund und Ländern zwar ein großes Problem gewesen. Durch die Novellierung des Online-Zugangsgesetzes und neue Regeln der gemeinsamen Nutzung von digitalen Anwendungen durch Länder und Kommunen seien die entsprechenden Rahmenbedingungen in jüngster Zeit jedoch erheblich verbessert worden.
„Dass diese Koordinationsprobleme angegangen wurden, war richtig und dringend notwendig, allerding wird das nicht reichen, um einen Digitalisierungsschub in Deutschland auszulösen“, warnt Prof. Dr. Berthold U. Wigger: „Ein weiteres zentrales Problem besteht darin, dass bisher die Frage weitgehend ausgeblendet wurde, wer die IT-Lösungen für die Verwaltungsdigitalisierung bereitstellt. In Deutschland beziehen öffentliche Verwaltungen digitale Leistungen vor allem bei öffentlichen IT-Dienstleistern, zu denen sie in einem Inhouse-Verhältnis stehen. Einen großen Teil digitaler Verwaltungsleistungen erwirbt der Staat mit anderen Worten nicht auf dem Markt, vielmehr produziert er ihn selbst.“ Wenn die Bereitstellung der digitalen Leistungen für die öffentliche Verwaltung überwiegend außerhalb des marktlichen Wettbewerbs stattfände, fehlten dadurch Anreize zur Qualitätsverbesserung und Kostenminimierung, die ein marktlicher Wettbewerb automatisch auslösen würde.
Laut dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft überzeuge es nicht, wenn die öffentlichen IT-Dienstleister ihre starke Position in der Verwaltungsdigitalisierung damit begründen, nur so sei digitale Souveränität sicherzustellen. „Es ist unstrittig, dass die öffentliche Verwaltung über Datensouveränität sowie infrastrukturelle Souveränität verfügen muss“, unterstreicht Feld. Dies treffe allerdings nicht unbedingt auf technische Souveränität zu, da diese bedeute, dass sich die öffentliche Verwaltung von kommerziellen IT-Anwendungen abschotte, sodass sie weder von Skaleneffekten noch innovativen Anwendungen profitieren könne.
„Private Unternehmen sind häufig flexibler und können schneller auf neue Anforderungen reagieren als öffentliche Unternehmen. Eine stärkere Öffnung des Marktes für die Versorgung der Verwaltung mit digitalen Leistungen für private IT-Dienstleister würde deshalb die Dynamik der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland deutlich erhöhen. Erfahrungen mit der Verwaltungsdigitalisierung in anderen europäischen Ländern wie Dänemark unterstützen diese Auffassung“, schlussfolgert Wigger.