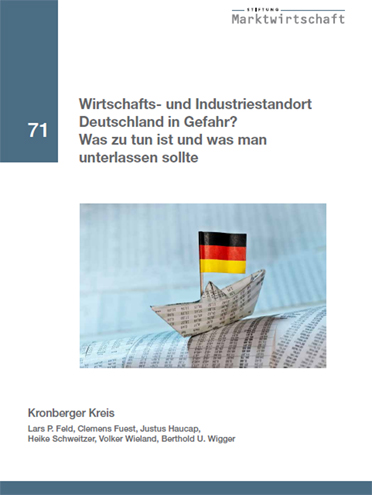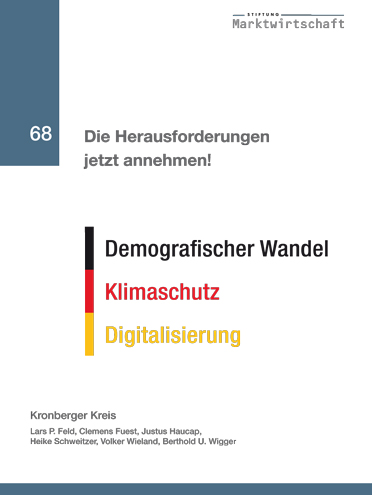Deutschland hat beschlossen, bis spätestens 2045 klimaneutral zu werden. Dazu wird im Rahmen der Energiewende ein grundlegender Umbau des deutschen Energiesystems angestrebt, den die Politik mit großen Kraftanstrengungen vorantreibt. Bei der Umsetzung der Energiewende- und Klimapolitik wird vor allem ein planerischer Ansatz verfolgt, bei dem der Staat am grünen Tisch passgenau festzulegen versucht, welche Regulierungen und Subventionen die einzelnen Sektoren und Technologien benötigen, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen.
Inzwischen wird immer deutlicher, dass dieser von Dirigismus und Wissensanmaßung geleitete Ansatz verfehlt ist: Deutschlands Energiewende ist konkurrenzlos teuer, die Energieversorgung ist perspektivisch nicht gesichert, die erzielten CO2-Einsparungen sind überschaubar und das versprochene „grüne Wirtschaftswunder“ bleibt aus. Die Energiewende wirkt, nur leider in eine Richtung, die den Wohlstand des Landes bedroht. Die politischen Maßnahmen sind oft nicht aufeinander abgestimmt, was dazu führt, dass positive Wirkungen des Emissionshandels durch eine Vielzahl lenkender Eingriffe überlagert werden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die deutsche Energiewende keine internationalen Nachahmer findet und die Stimmung in weiten Teilen der Gesellschaft und Wirtschaft in Bezug auf die Umsetzung der Energiewende gekippt ist: Ein zunehmender Teil der Bevölkerung ist mit der Energiewende- und Klimapolitik unzufrieden, während immer mehr Unternehmen planen, ihre Produktion einzuschränken oder ins Ausland zu verlagern.
Um das Ruder noch herumzureißen, bedarf es eines neuen Ansatzes, bei dem die Energiewende im Dialog mit Wissenschaft, Unternehmen und Gesellschaft stärker auf Ordnungspolitik (Anreize und Rahmensetzung) als auf ein kleinteiliges Ordnungsrecht (Regulierung und Verbote) oder eine großzügige Förderpolitik ausgerichtet ist. Um die Akzeptanz der Bevölkerung und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft wiederherzustellen, ist eine Politik erforderlich, bei der Energie nicht nur sauber, sondern zugleich sicher und bezahlbar ist. Deutschland braucht eine marktwirtschaftlich ausgerichtete Energiewende, die Wirtschaftswachstum und Klimaschutz miteinander verbindet, auf einheitliche CO2-Preise als wichtigsten Anreizmechanismus setzt und technologischen Fortschritt ermöglicht.
Um bei der Energiewende- und Klimapolitik die gesetzten Ziele effizient und effektiv zu erreichen, muss Deutschland andere Prioritäten setzen:
• Statt Dirigismus und Subventionen sollte stärker auf Marktmechanismen wie die CO2-Bepreisung gesetzt werden. Der europäische Emissionshandel hat gezeigt, dass klimapolitische Ziele sicher und kosteneffizient erreicht werden können.
• Innovationen sollten eine stärkere Rolle einnehmen, die bestenfalls aus der deutschen Energiewende hervorgehen und CO2-arme Technologien hervorbringen, die im In- und Ausland Treibhausgase wirksam reduzieren, abscheiden und speichern können.
• Das inländische Energieangebot sollte technologieoffen ausgeweitet werden, um eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung jenseits von Solar-, Wind- und Wasser(stoff)kraft zu gewährleisten.
• Den fragmentierten EU-Energiebinnenmarkt gilt es zu stärken, grenzüberschreitende Netze schneller zu realisieren und modernisieren. Dazu sind schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie smarte Netze erforderlich.
• Außerdem ist es aufgrund der globalen Dimension des Klimawandels erforderlich, stärker auf internationale Kooperation zu setzen sowie Anpassungsstrategien an den Klimawandel zu entwickeln. Ein Klima-Club sollte möglichst viele Staaten einbinden und weltweit einheitliche CO2-Preise anstreben